|
Ein Nebelsignal ist ein akustisches Signal, das bei schlechtem Wetter (Dunst
oder Nebel) von einem Schiff oder Leuchtturm zur Warnung und Orientierung
ausgegeben wird. Als Hilfsmittel für die Ortsbestimmung haben Schallzeichen nur
bedingten Wert, weil Abstand und Peilung der Schallquelle nicht immer ganz
zuverlässig ausgemacht werden können. Die atmosphärischen Verhältnisse haben
einen großen Einfluss auf die Hörweite. Wenn der Schall gegen den Wind laufen
muss, kann es vorkommen, dass er nach oben abgelenkt wird. Dann kann ein
Ausguckmann im Topp möglicherweise noch Nebelschallzeichen hören, während an
Deck oder auf der Brücke diese nicht mehr zu hören sind. Auch beeinflussen
wechselnde Temperaturen und Luftdichte von benachbarten Luftschichten die
waagerechte Ausbreitung der Schallwellen und lenken sie unter Umständen
beträchtlich nach oben oder unten ab oder bilden ein Echo. Je dichter der Nebel,
desto deutlicher hört man den Widerhall.
Geräusche in der Luft "driften mit dem Wind“ und bewirken, dass die Reichweite
nach Lee zunimmt und nach Luv abnimmt. Die Reichweite von Nebelsignalen ist in
der Praxis daher recht begrenzt.
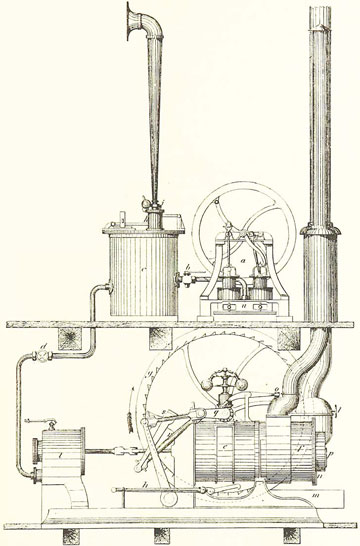 Die
frühesten Geräte zur Erzeugung eines Nebelsignals bestanden darin, etwas
anzuschlagen, das einen Ton erzeugte, beispielsweise eine Nebelglocke,
Gong, Trommel, Mundtrompeter und Sprachrohr. Eine Nebelglocke sieht aus wie eine kleinere Kirchenglocke. Die
frühesten Geräte zur Erzeugung eines Nebelsignals bestanden darin, etwas
anzuschlagen, das einen Ton erzeugte, beispielsweise eine Nebelglocke,
Gong, Trommel, Mundtrompeter und Sprachrohr. Eine Nebelglocke sieht aus wie eine kleinere Kirchenglocke.
Dann kamen
Nebelsignalkanonen und Knallsignalgeräte zum Einsatz. Ursprünglich bestanden die
Nebelsignalkanonen aus den Vorderladern alter Kriegsschiffe. Der Knallschuss
bestand aus einer kleineren Sprengladung mit Trotyl. Die Sprengschüsse wurden
durch Ankurbeln eines elektrischen Induktionsgenerators abgefeuert. Die
Handhabung der Nebelsignalkanonen war allerdings nicht ganz ungefährich. 1905
kam der Leuchtturmwärter von Hela dabei ums Leben.
Im Jahre 1819 erfand der französische Ingenieur und Physiker Cagiard de la Tour
die mit Pressluft betriebene Sirene. Damit hatte er eine Möglichkeit gefunden,
die noch unzureichenden Lichtquellen der Leuchtfeuer im küstennahen Raum
akustisch zu ergänzen. Dies hatte eine große Bedeutung, denn nimmt man einem Menschen die Sicht, so ist er ohne andere Mittel recht hilflos. Man braucht nur
an die vielen Schiffsunfälle bei dichtem Nebel zu denken.
Ab 1875 begann der Bau von
Nebelsignalstationen, und ab 1879 bemühte man sich um die Verbesserung der
Hörweite, der Tonhöhe und des Antriebs. Zu diesem Zweck wurden Maschinenhäuser
eingerichtet,
in denen Dampf oder Pressluft für Nebelhörner erzeugt wurde. Diese
Nebelhörner erzeugten einen Schalldruckpegel von bis zu 140 dB (A) und waren in
einer Entfernung von über fünf Kilometern noch zu hören. Die Antriebsmaschinen
wurden mit Kohle oder Öl befeuert. Neben diesen kostspieligen und aufwendigen
Einrichtungen wurden noch bis ins erste Drittel des 20. Jahrhunderts  hinein
Schiffskanonen, die Warnschüsse abgaben, eingesetzt. Außerdem gab es bis dahin
auch noch
Nebelglocken, die in Intervallen geschlagen wurden. hinein
Schiffskanonen, die Warnschüsse abgaben, eingesetzt. Außerdem gab es bis dahin
auch noch
Nebelglocken, die in Intervallen geschlagen wurden.
Hatte man bisher die Schifffahrt durch abgefeuerte Warnschüsse, durch das Läuten
von Glocken auf Gefahren aufmerksam gemacht, so boten sich im nächsten
Jahrhundert noch andere Möglichkeiten an, z.B. Nebelsignalstationen mit Nebelhörnern (Typhons), Membransendern, Sirenen- und
Wasserschallsignalen. Bevorzugt wurden die mit Pressluft betriebenen
Kolbensirenen. Sie waren anderen Geräten der Signalerzeugung überlegen.
Aber trotz guter Ergebnisse suchte man ununterbrochen nach neuen Schallquellen,
um die
Schifffahrt noch sicherer zu machen. Denn oft bot der für die Navigation
wichtigste Orientierungspunkt nicht den geeigneten Baugrund für die
Schallquelle, oder die erforderliche Fläche für die Maschinenstation reichte
nicht aus. Die Rohrleitungen für die Pressluft können nicht beliebig lang sein.
Mängel wie Dämpfung, Verzerrung der Morsezeichen, Energieverluste und
Störempfindlichkeit sind ab einer bestimmten Entfernung zwischen Schallsender
und Energieerzeuger nicht mehr zu vermeiden.
1899 wurde auf dem Hochufer bei Stubbenkammer auf Rügen eine Nebelsignalstation
mit Dampf betriebenem Nebelhorn errichtet.
 1911 folgte eine Nebelstation an der
Küste vor Wustrow auf Fischland-Darss-Zingst. 1911 folgte eine Nebelstation an der
Küste vor Wustrow auf Fischland-Darss-Zingst.
Wie bei den Leuchtfeuern hielt die
Elektrizität auch bei den Nebelsignalstationen ihren Einzug.
Die Verlegung von
Kabeln macht keine besonderen Schwierigkeiten. Damit begannen sich in den 1920er
Jahren elektrische, wartungsfreie Membranluftschallsender durchzusetzen. Die
elektrische Energie bringt dabei eine Membran in Schwingungen, die als
Schallschwingungen über einen Trichter nach außen geleitet werden. Um 1937 hatte
diese neue Technik den Kolbensirenen endgültig den Rang abgelaufen. Der Grund
dafür waren nicht die Vergleiche zwischen den beiden
Luftschallsendemöglichkeiten, die zugunsten der Elektromagnetsender ausfielen,
sondern vor allem der geringere Energieverbrauch bei gleicher Tragweite des
Schalls, die geringeren Anschaffungs- und Betriebskosten sowie die präzisere
Steuerung der Signale.
1963 wurde ein schwedischer Nebeldetektor patentiert
und in alle Teile der Welt verkauft. Der automatische Nebelmelder war eine der
Voraussetzungen für die Automatisierung der bemannten Leuchttürme. Die frühen
Modelle waren mechanisch und nutzten den Effekt einer leichten Verlängerung
eines Haares in feuchter Luft, das ein Ventil steuerte. Spätere Modelle
basierten darauf, dass die Wassertropfen im Nebel IR-Strahlung reflektieren.
Moderne Nebelmelder senden einen Infrarotstrahl aus, um die Reflexion der
Wasserpartikel in der Luft zu messen und bei bestimmten Sichtweiten das
akustische Signal zu aktivieren. Als Nebelmelder werden zuverlässige
Sichtweitensensoren (Hydrometeore) verwendet, die für den Einsatz an
abgelegenen Wetterstationen entwickelt wurden. Diese können durch starken Regen
oder Schnee sowie durch Nebel aktiviert werden.
Die letzten akustischen Nebelschallanlagen wurden mit Membran-Nebelschallsendern
realisiert. Mittlerweile wurden fast alle Nebelschallanlagen an den Küsten
außer Betrieb genommen und durch LED-Nebelfeuer ersetzt. Allerdings werden am
Bodensee bis heute noch neben Nebelglocken auch Nebelsirenen eingesetzt.

Membranschallsender der Firma AGA
Ein weit verbreiteter Membranschallsender war der von der Firma AGA ab Ende der
1960er Jahre hergestellte Sender LIE-300. AGA stellte ihn als rundstrahlenden
und gerichteten Schallsender aus Gusseisen und aus Leichtmetall her.
Jede
Einheit ist mit zwei Membranen versehen, die von einem Statorring getrennt sind.
Die Membranen sind mit U-förmigen Polschuhen versehen, die sich in dem von den
zwei Magnetspulen erzeugten Feld bewegen können. Diese Spulen werden mit
Wechselstrom mit einer Frequenz von 150 Hz gespeist. Da der Wechselstrom zwei
Maxima pro Periode durchläuft, schwingen die Membranen mit einer Frequenz von
300 Hz. Dadurch wird auch die Luft in den Resonatoren (Schalltrichtern) in
Schwingung versetzt und der Schalltrichter sendet einen 300-periodischen Schall
aus.
Montage
Der unterste Schalltrichter eines Senders darf niemals niedriger als 2,5 m über
dem Boden (oder dem Dach) montiert werden. Die Fläche unmittelbar unter dem
Sender muss gebrochen oder schief sein, um starke Schallreflexe zu vermeiden.
Solche Reflexe können allzu große Membranamplituden verursachen.
Stromspeisung
Gewöhnlich wird der 150-periodische Wechselstrom, der für den Betrieb des
Schallsenders erforderlich ist, über Frequenztransformatoren von einem 50
Hz-Netz betrieben. Falls die Anlage von einem Motorgenerator gespeist wird, muss
der Ungleichförmigkeitsgrad besser als 1:160 sein um Tonschwankungen zu vermeiden.
Nominale Reichweite von Tonsignalsendern
Die Entfernung, bei der ein Ausguck auf der offenen Brückennock bei Nebel eine
Wahrscheinlichkeit von 90 % hat, das Signal zu hören, wenn er normalen
Geräuschen ausgesetzt ist, die auf 84 % der großen Handelsschiffe vorherrschen.
Die Tabelle zeigt den erforderlichen Schalldruckpegel in Dezibel bei
unterschiedlichen Frequenzen an, der erforderlich ist, um das Tonsignal in einer
bestimmten Entfernung hören zu können.
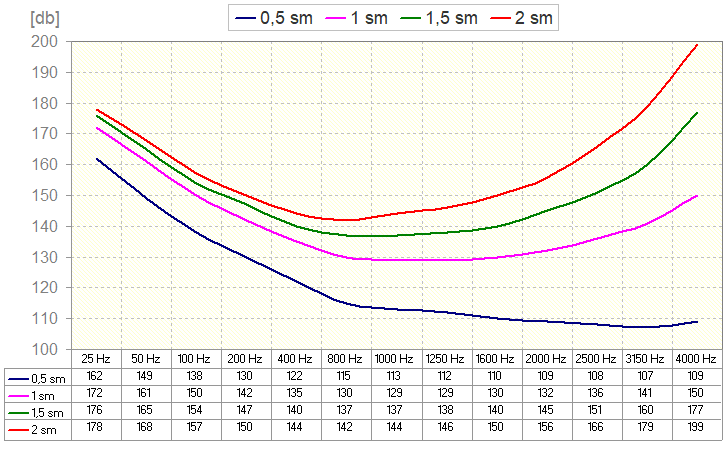
Hörbare Signale auf schwimmenden Seezeichen
Akustische
Signale können zur Ergänzung von beleuchteten und unbeleuchteten Tonnen
verwendet werden, um deren Wirksamkeit für den Seefahrer bei eingeschränkter
Sicht zu erhöhen. Akustische Signale auf Tonnen werden meist durch die Bewegung
des Meeres angetrieben und umfassen Glocken, Gongs und Pfeifen. Tonnen können
auch mit elektronischen Hupen ausgestattet sein.
Akustische Signale auf Tonnen
werden verwendet, um Seefahrer vor einer bestimmten Gefahr zu warnen, wie etwa
der Nähe zu Untiefen, Felsen, oder um den Seefahrer auf eine Änderung der
Navigation aufmerksam zu machen, wie etwa die Einfahrt in einen gesperrten
Kanal.
Wenn elektronische akustische Signale zur Ergänzung von Tonnen verwendet
werden, sollen sie normalerweise eine Reichweite von 0,25 bis 0,5 Seemeilen
haben.
Das Bild rechts zeigt den Nachbau einer Ansteuerungstonne mit einer
Nebelglocke, deren Glockenschlagwerk durch die Wellenbewegung erzeugt wird.
Landfeste Nebelsignalstationen
| Name |
Kanone |
Glocke |
Horn |
Sirene |
el. Membransender |
| Alte Weser |
|
|
|
|
1964 |
| Amrum |
|
|
|
|
~1939 |
| Arkona |
|
|
|
1888 |
1930 - 1987 |
| Bremerhafen Nordschleuse |
|
|
|
|
1943, 2014 Horn |
| Bremerhafen Ostschleuse |
|
1900 |
|
|
2014 Horn |
| Brikamahof |
|
1910 |
|
|
|
| Bülk |
1857 |
|
1904 |
|
1932 |
| Büsum Westmole |
|
|
1925 |
|
1928 |
| Dameshöved |
|
|
|
|
1934 |
| Darßer Ort |
1880 |
|
1911 |
1912 |
1936 |
| Dornbusch |
1888 |
|
1911 |
1912 |
1936 |
| Emden Westmole |
|
|
|
|
1952 - 2020 |
| Fischerbalje |
|
|
|
|
1961 - 1976 |
| Friedrichsort |
|
1866 |
|
|
1937 |
| Geeste Nordmole |
|
|
1909 |
|
1951 - 1993 |
| Geeste Südmole |
|
1878 |
|
|
|
| Greifswalder Oie |
1894 |
|
|
1911 |
1938 - 1987 |
| Gollwitz |
|
|
|
|
~1937 |
| Großenbrode Fähre |
|
|
|
|
1937 |
| Großer Vogelsand |
|
|
|
|
1974 - 2004 |
| Alte Liebe |
|
1900 |
|
1909 |
1929 |
| Helgoland |
1877 |
|
|
1912 |
1934 - 1983 |
| Hoheweg |
|
1888 |
|
|
|
| Kalkgrund |
|
|
|
|
1963 - 2019 |
| Kiel |
|
|
|
|
1967 - 2020 |
| List-West |
|
|
|
|
1953 - 1981 |
| Marienleuchte |
|
|
|
1879 |
1930 |
| Mellumplate |
|
|
|
|
1942 |
| Meyers Ledge alt |
|
1887 |
|
|
|
| Meyers Ledge neu |
|
1906 |
|
|
|
| Minsener Oog Buhne A |
|
|
|
|
1940 - 1989 |
| Norddeich |
|
1927 |
|
|
1936 - 1978 |
| Obereversand |
|
1887 |
|
|
|
| Roter Sand |
|
1885 |
|
|
1935 |
| Sassnitz Ostmole |
|
|
1903 |
|
1937 |
| Sassnitz Westmole |
|
1914 |
|
|
|
| Schleimünde |
|
|
|
|
>1925-2015 |
| Staberhuk |
|
|
|
|
1936 |
| Stubbenkammer |
1899 |
|
1913 |
1916 |
1936 |
| Timmendorf |
|
|
|
|
~1938 - 1996 |
| Untereversand |
|
1887 |
|
|
|
| Voslapp |
|
1907-1961 |
|
|
|
| Wangerooge |
|
|
1910 |
1886 |
1927 - 1974 |
| Warnemünde Westmole |
|
|
|
|
1929 |
| Wustrow |
|
|
1911 |
|
1922 - 1987 |
|